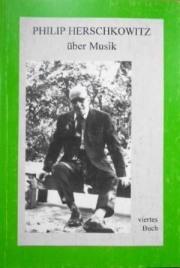Fragmente zu "Tonalität und Zwölftonsystem"
Eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Zwölftonsystem ist nur auf der Grundlage einer ebensolchen Auseinandersetzung mit der Tonalität denkbar. Diese Grundlage hat eben Schönberg selbst in seiner 1911 erschienenen “Harmonielehre” geliefert. Ohne eine Abson¬derung dessen, was in der Schönbergschen Darstellung des tonalen Systems wirklich neu ist, vom herkömmlich Bekannten anzustreben, kann man sie folgendermaßen kurz zusammenfassen: Die Wesenheit des “Tonalität” genannten Tonsystems fin¬det ihren Ausdruck in der Herrschaft eines Tons - der Tonika - über alle anderen Töne. Diese Herrschaft beruht auf dem Gleichgewichtsverhältnis der zueinander gegensätzlichen Dominante und Unterdominante. Das Gleichgewichtsverhältnis der Dominante mit der Un¬terdominante verwirklicht sich unter den Bedingungen der Un¬gleichheit ihrer Kräfte: die Unterdominante ist stärker als die Dominante, und stärker sogar als die Tonika und Dominante zu¬sammengenommen. Dies ist darauf zurückzuführen, daß so¬wohl die Dominante zur Tonika, als auch die Tonika zur Un¬terdominante genauso sich verhalten, wie einer der nächsten Obertöne - der zweite[1] Oberton - sich zum Grundton verhält. Eben das Verhältnis des zweiten Obertons zum Grundton ruft das Bestreben - das stärkste(!) Bestreben - eines jeden Tons hervor, sich in einen ändern, eine Quint tiefer liegenden Ton aufzulösen. Die eingehende Auseinandersetzung mit diesen Erkenntnissen führt zu einer Verallgemeinerung, die deren Erweiterung gleich¬kommt und welche folgendermaßen dargelegt werden kann: Die Be¬schaffenheit des Tons übt einen Einfluß auf die Beziehungen der Töne zueinander aus. Im selben Zusammenhang, in welchem der Ton die Summe seiner Obertöne bildet, hat er - auf einer höheren Ebene - den Hang, selbst als Oberton aufzutreten, d. h., sich einem anderen Ton unterzuordnen, der die Fähigkeit besitzt, ihm gegenüber die Funktion eines (mehr oder weniger starken) Grundtons präsumptiv auszuüben. Das tonale System bildet eigentlich den Damm und die Schleuse, welche auf dieses Streben des Tons bremsend und richtung¬gebend einwirken. Die Tonika hat in einem jeden gegebenen Werk zu “beweisen”, daß sie einen “Grundton” (einen realen Ton) darstellt, der den Hang Ober¬ton zu werden losgeworden ist. Das Gleichgewichtsverhältnis zwi¬schen Dominante und Unterdominante ist eben dazu da, um die Toni¬ka gegen eine jede Anziehungskraft - letzten Endes gegen die Anzie¬hungskraft der Unterdominante allein - zu feien. Eben auf die von diesem Verhältnis sichergestellte Unanfechtbarkeit der Tonika ist de¬ren Herrschaft über die anderen Töne, und somit auch das ganze Wesen des tonalen Systems zurückzuführen. Da aber Ton und Musik Erscheinungen sind, die nicht dem Raum sondern der Zeit angehören, und demenentsprechend auch das tona¬le Gleichgewicht nicht anders als in der Zeit sich offenbart, ist letz¬teres nicht als Zustand, sondern als Prozeß zu verstehen und wahrzu¬nehmen. Die Abwicklung dieses Prozesses hat den Namen “Musikform” be¬kommen, als “Musikform” ist er im Laufe der Geschichte vom Be¬wußtsein des Menschen erfaßt worden. Man könnte sagen, daß dieser in die Musikform eingebettete Reali-sierungsprozeß des tonalen Gleichgewichts deren eigentliche Dyna¬mik darstellt. In ihrer Unzertrennlichkeit verhalten sich Harmonie und Form genauso zueinander, wie Höhe und Länge (Dauer) des Tons - seine zwei Hauptattribute - sich zueinander verhalten. Harmonie und Form sind Emanationen dieser zwei Attribute des Tons, die, von den anderen seiner Attribute unabhängig, ihn als Motor der Musik-entwicklung bestimmen. Unter diesem Gesichtspunkt bekommen die harmonischen Haupt¬begriffe Sinn und Bedeutung von formalen Kategorien. Als formale Kategorie ist die Tonika anzusehen, wenn sie, in Gestalt der Haupt¬tonart, ihre Verkörperung im Hauptsatz findet. Eine ebensolche Ver¬körperung findet die in Gestalt der Dominanttonart auftretende Do¬minante im Seitensatz. Im ersten Leitsatz der “Harmonielehre” spricht Schönberg einen Gedanken aus, dem die Bedeutung einer Entmystifizierung der Be¬griffe “Konsonanz” und “Dissonanz” zukommt. In wenigen Worten zusammengefaßt, kann man heutzutage diesen Gedanken folgender¬maßen ausdrücken: Zwischen Konsonanz and Dissonanz gibt es keinen qualitativen, sondern nur einen quantitativen Unterschied. Im Sinne eines (auf das Jahr 1911 bezogenen) “Präsens historicum” muß in diesem Zusammenhang folgendes dargelegt werden. Konso¬nanz und Dissonanz sind nicht durch einen Graben getrennt. Ein und dasselbe Klangverhältnis (Intervall oder Akkord ) wird von verschie¬denen Generationen verschiedentlich aufgefaßt. Eine heutige Konso¬nanz ist gestern Dissonanz gewesen, und umgekehrt, ein Zusammen-klang, der gegenwärtig als Dissonanz gewertet und empfunden wird, tarnt eine künftige Konsonanz in sich. Die Fähigkeit, ein Verhältnis zweier Töne als Konsonanz wahrzunehmen, ist als Ergebnis eines langwierigen Vorgangs zu betrachten; nur dessen Abschluß kann das gegebene Tonverhältnis von der Zugehörigkeit zur Kategorie der Dis¬sonanzen erlösen. Somit ist eine jede Konsonanz als “geläuterte” Dissonanz anzusehen. Die Gegensätzlichkeit der zwei Intervallkategorien ist also nicht eine wesenhafte. Der Übergang eines Intervalls aus einer Kategorie in die andere - aus der Kategorie der bedingt zugelassenen Intervalle in die Kategorie, in welcher deren Zulässigkeit keine Schranken gesetzt werden - hängt nicht von den Tönen, sondern vom empfangenden Gehör ab. Die Dissonanz und die Konsonanz sind beziehungsweise Objekte einer relativen und einer absoluten Wahrnehmung. Auf Grund des stufenweise vor sich gehenden Prozesses der Gehörsentwicklung geschieht die Umwandlung des Relativ-Wahrgenommenen in ein Ab- solut-Assimiliertes, welches als solches seinen Platz im - ad hoc er¬weiterten - allgemeinen Musik-Weltbild automatisch findet. So eben, langsam (aber sicher...), dreht sich das Rad der Musikgeschichte. In diesem Zusammenhang drängt sich die Frage auf: In welcher Reihenfolge werden die Intervalle “assimiliert”? Man kann diese Fra¬ge auch anders stellen: Welche Dissonanzen werden leichter, und wel¬che schwerer vom Gehör als solche überwunden? Das heißt: Wovon wird die Reihenfolge bedingt, in welcher die Dissonanzen, eine nach der ändern, sich - faktisch - in Konsonanzen verwandeln? Die Antwort enthüllt einen sehr merkwürdigen Sachverhalt: Die gründliche Aneigung der Intervalle durch das Gehör darf nicht als Selbstzweck beurteilt werden; als Vorgang ist sie dem Vorgang der Wesensergründung des Tons selbst untergeordnet; der eine Prozeß, - der untergeordnete, - deckt den anderen, und somit identifizieren sie sich weitgehend miteinander; die Scheidewand zwischen ihnen be-ginnt erst dann sichtbar zu werden, wenn Umwandlungen von Disso¬nanzen in Konsonanzen unumgänglich die Umwandlung eines Ton¬systems in ein anderes mit sich bringen. Es ist eine sonderbare Wahrheit: einerseits drückt das Intervall die Beziehung zweier Töne aus; andrerseits ist der Ton als Synthese aller Intervalle zu betrachten. Dieses “Einerseits” und dieses “Andrerseits” befinden sich aller¬dings in zwei verschiedenen Ebenen: Das Intervall als Beziehung zweier Töne ist eine Erscheinung, ohne welche keine Musikpraxis im eigentlichen Sinne dieses Wortes denkbar wäre, die aber primär ganz etwas anderes als eine solche Beziehung darstellt; hingegen ist “die Synthese aller Intervalle”, - der Ton nie anders denn als ein Un¬teilbares Gegenstand der Wahrnehmung durch das Bewußtsein - und also auch der Praxis - gewesen. Die Erkenntnis eines Intervalls ist die Erkenntnis eines Teils des Wesens des Tons. Und so ist die ganze Musik und ihre ganze Geschichte: der Ton. Der Ton ist abstrakt. Der gehörte Ton - ist nur Schatten des Tons. In seinem Wesen läßt er sich nur als Teil und mittelbar wahrnehmen: als Intervall... obwohl er doch wirklich ein Zusammengesetztes ist. Obertöne aber gibt es unzählige. In ihrer unabänderlichen Reihen¬folge bilden sie das Spektrum des Grundtons; ein spektrumähnliches Gebilde, welches das eigentliche Wesen eines jeden realen Tons aus¬macht, aber zu seiner vollkommenen Offenbarung nur dort kommt, als Tonika, wo er, dieser “Grund”-Ton, als Wunder-Werk eines grossen Meisters sich entfaltet. Die absolute Reihenfolge der Obertöne ist aber nur durch Inter¬valle auszudrücken. Somit deckt sich (mindestens weitgehend) die Ergründung des Tons selbst mit der Ergründung der Intervalle. Bes¬ser gesagt: die völlig unbewußte Ergründung des Tons hat sich jahr¬hundertelang als - weniger unbewußte - Ergründung der Intervalle ausgegeben. Ein jeder realer (konkreter) Ton stellt eine Struktur dar, in wel¬cher alle anderen Töne, eine virtuelle Unendlichkeit bildend, als ihre Bestandteile auftreten. Ein jeder einzelner Ton (der “Grundton ”) ist von allen anderen Tönen (“Obertönen”) in ihrer Gesamtheit4 gebil¬det. Der Unterschied liegt nicht einmal in der Ordnung dieser Gesamt¬heit. Diese ist unabänderlich. Der Unterschied liegt in dieser inneren Ordnung, die ein jeder gegebener Grundton bedingt. Wenn man sagt “Ton”, - realer Ton, - da sagt man “Grundton”; und wenn man “Grundton” sagt, da soll man “Tonika” verstehen. In seinem Wesen gibt es nur einen Grundton (der transponiert werden kann!); Die Fragmente tragen die Überschrift "Tonalität und Zwölftonsystem ". Ausgewählt wurden für vorliegende Publikation nur solche Passagen aus dem Manuskript, die nicht mit den Gedankengängen und Formulierungen des vorhergehenden oder des folgenden Textes in diesem Buch identisch sind. Ein russischer Text gleichen Titels: Додекафония и тональность ist veröffentlicht in: I, 214-246. Bei diesem handelt es sich um eine Analyse des ersten Satzes von Schönbergs Suite op. 25. Die Fragmente, denen die hier vor¬gelegten Passagen entnommen sind, behandeln dagegen nur die allgemeinen Fragen von Tonsystem und Form.
Примечания
- ↑ Der erste Oberton zählt nicht, da er in Bezug auf den Grundton das Oktavenintervall bildet, und somit völlig sich mit ihm identifiziert. Deswegen kommt dem zweiten Oberton die wirkliche Geltung eines ersten "echten" Obertons zu.