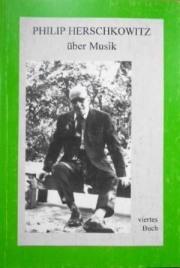Die tonalen Quellen des Schönbergschen Zwölftonsystem
Selbstverständlich muß in einem ersten Augenblick die Vorstellung, daß es eine organische Beziehung zwischen Tonalität und Zwölftonsystem gibt, den Eindruck eines Unsinns machen: im Gegensatz zur Tonalität, die eine Naturerscheinung ist, stellt das Zwölftonsystem nichts anderes als eine Schöpfung des Menschen dar. Als Ergebnis einer näheren Untersuchung stellt sich aber die Einsicht ein, daß diese Beziehung nichts mit einer Unsinnigkeit gemein hat. Das Entstehen eines künstlichen Tonsystems in der Epoche, in welcher die künstliche Radioaktivität aufgekommen ist, darf nicht als Zufall betrachtet werden. Sowohl das eine als auch das andere widerspiegelt das Maß und die Qualität der Änderungen, die in unserem Jahrhundert die Beziehungen zwischen Mensch und Natur erlitten haben widerspiegelt die neuen Züge, welche nun diesen Beziehungen eigen sind.
Das Zwölftonsystem ist — genauso wie die künstliche Radioaktivität — eine mittelbare Naturerscheinung. Während aber die sekundäre Naturgegebenheit der letzteren offenbar ist, muß diejenige des hier behandelten Tonsystems bewiesen werden, und zwar dadurch, daß man dessen organische Beziehung zur Vergangenheit der Musik aufdeckt.
Dem Weg nachzuspüren, der von der Tonalität zum Zwölftonsystem geführt hat, — d. h. vom Tonsystem, dessen Wesen von einer Tonika bedingt ist, zum Tonsystem, in welchem es keinen Platz für eine solche gibt, — ist das Ziel dieses Aufsatzes. Der Ausgangspunkt der hier unternommenen Untersuchung ist von drei eng miteinander verbundenen Leitsätzen gebildet, die aus der "Harmonielehre" Schönbergs entlehnt sind, — dem Buch, welches 1911, fast um 15 Jahre früher als die ersten Schönbergschen Zwölftonwerke, erschienen ist.
Der erste dieser Leitsätze bezieht sich auf die Begriffe "Konsonanz" und "Dissonanz". Schönberg ist wohl der erste gewesen, dem der Gedanke gekommen ist (und jedenfalls der erste, der den Gedanken ausgesprochen hat), welcher das Wesen dieser zwei Begriffe entschieiert. Man könnte vielleicht diesen Gedanken am besten mit den Worten ausdrücken: Zwischen Konsonanz und Dissonanz gibt es keinen qualitativen sondern einen quantitativen Unterschied.
Konsonanz und Dissonanz sind nicht durch einen Graben voneinander getrennt. Ein und derselbe Zusammenklang (Intervall oder Akkord[1]) wird von verschiedenen Generationen verschieden wahrgenommen. Eine jede gegenwärtige Konsonanz ist in der Vergangenheit Dissonanz gewesen, genauso wie ein jeder Zusammenklang, der heute als Dissonanz gilt, in einer näheren oder ferneren Zukunft sich in eine Konsonanz verwandeln wird. Man kann also mit anderen Worten sagen, daß eine jede Konsonanz eine "geläuterte" Dissonanz darstellt.
Die Zugehörigkeit zu einer der zwei Intervall-Kategorien wird nicht von der Beschaffenheit des gegebenen Intervalls, sondern von dem es wahrnehmenden menschlichen Gehör bestimmt. In diesem Zusammenhang kann man verstehen, daß der geschichtliche Prozeß der Musikentwicklung den Gehörentwicklungsprozeß widerspiegelt, in dem jeder Schritt vorwärts durch den Übergang des fälligen Zusammenklangs aus der Kategorie der Dissonanzen in die Kategorie der Konsonanzen im Menschenbewußtsein gekennzeichnet ist. Solange die Wahrnehmung des gegebenen Zusammenklangs nur eine relative ist, stellt er eine Dissonanz dar; wenn im weiteren Verlauf der Gehörentwicklung diese Wahrnehmung von einer relativen in eine absolute sich verwandelt, scheidet der Zusammenklang aus der Dissonanzen-Kategorie aus.
In diesem Zusammenhang taucht folgende Frage auf: In welcher Ordnung geht die Aneignung der Zusammenklänge vor sich? Man kann diese Frage auch anders formulieren: Welche Zusammenklänge eignen sich leichter an, und welche — schwerer? Oder: Wodurch ist der Schwierigkeitsunterschied dieser Aneignung bedingt?
Auf dem Weg, der zur Amtwort dieser Fragen führt, geht man an einer sonderbaren Wahrheit vorbei: der Aneignungsprozeß der Intervalle durch das Gehör des Menschen ist kein Selbstzweck, sondern stellt das Verwirklichungsinstrument eines anderen, viel tieferen Entwicklungsprozesses dar, und zwar desjenigen, dessen Objekt die Fähigkeit ist, das Wesen des Tons selbst in seiner Gänze zu erfassen. Hier handelt es sich also um folgende paradoxale Tatsache: einerseits bildet das Intervall die Entfernung zweier Töne voneinander; andrerseits aber drängt sich unserem Betrachtungsvermögen der Ton als Synthesis aller Intervalle auf.
Untrennbar vom Wesen des Tons sind seine Obertöne, welche in ihrer Gesamtheit mit hinlänglichem Grund als sein Spektrum aufgefaßt werden können. Die Entfernung vom Grundton (realen Ton) eines jeden seiner aufeinanderfolgenden Obertöne ist von einem Intervall gebildet, welches für den gegebenen Oberton (was seine Ordnungszahl in der Obertonreihe betrifft!) charakteristisch ist. Die Beziehung des Grundtons zu seinem ersten Oberton findet ihren Ausdruck in der Oktav, zu seinem zweiten Oberton — in der reinen Quint u. s. w. Folglich ist die Struktur der Obertonreihe in der Gesamtordnung der Intervalle zu suchen, welche die Beziehungen des Grundtons zu seinen Obertönen ausdrücken.
Aber eben daraus ergibt sich, daß die von den Intervallen bedingte Struktur der Obertonreihe die Ordnung und den Grad der Aneignung dieser Intervalle durch das Gehör bestimmt: Je größer die Nähe des Obertons zum Grundtàn, um so leichter wird das Intervall wahrgenommem, welches diesem Oberton entspricht. Und eben in diesem Zusammenhang ist es zu verstehen, daß der Unterschied zwischen Dissonanz und Konsonanz nicht als ein qualitativer, sondern als ein quantitativer betrachtet werden muß: Die Intervalle, welche die Beziehungen des Grundtons zu seinen fernen Obertönen ausdrücken, werden im Laufe einer gegebenen Epoche nach wie vor als Dissonanz empfunden und betrachtet werden, während die auf nähere Obertöne sich beziehenden Intervalle sich jene Gehörszugänglichkeit schon erobert haben, auf deren Grund sie als Konsonanzen betrachtet, oder — einstweilen — mindestens als solche behandelt werden[2].
Die Tatsache, daß die Faßlichkeit eines Intervalls von der Nähe des Grundtons zum ihm entsprechenden Oberton abhängt, erklärt sich durch die Wesensart der Einheit, welche Grundton und Obertöne miteinander bilden: je näher der Oberton zum Grundton, umso größer seine, Ähnlichkeit mit ihm.
Dem ersten Oberton entspricht das Intervall, dessen Faßlichkeit die allergrößte ist, — die Oktav, — eben weil er die größte Ähnlichkeit mit dem Grundton aufweist. Dank dieser absoluten Ähnlichkeit kann der erste Oberton als offenbare Wiederholung des Grundtons wahrgenommen werden. Dies erlaubt uns zu verstehen, — da allen Obertönen ein und dasselbe Wesen eigen ist, — daß alle Obertöne dem Grundton ähnlich (und als seine Wiederholungen aufzufassen) sind. Nur aber wird diese Ähnlichkeit (weil auch der ihr entsprechende Wiederholungsmaßstab) nach und nach — von Oberton zu Oberton — immer kleiner.
Wie winzig diese Verminderung beim Erscheinen des nächsten — zweiten — Obertons auch sei, genügt sie, um einen großen Unterschied zwischen diesem Oberton und dem ihm vorangehenden zu verursachen: während die Ähnlichkeit des ersten Obertons mit dem Grundton als eine absolute wahrnehmbar ist, kann diejenige des zweiten Obertons nur noch als relative Ähnlichkeit betrachtet werden. Dies gibt sich zuallererst daran kund, daß die Tonbenennung des zweiten Obertons, im Gegensatz zur Tonbenennung des ersten, nicht identisch mit der des Grundtons ist. Nichtsdestoweniger besitzt der zweite Oberton jene hinlängliche Ähnlichkeit mit dem Grundton, welche das ihm entsprechende Intervall — die reine Quint — befähigt, zusammen mit der Oktav die gesonderte Kategorie der "vollkommenen" Konsonanzen zu bilden. So tief ist die Wesenseinheit, welche Oktav und reine Quint miteinander verbindet und den anderen Konsonanzen entgegensetzt, daß eine jede von beiden sich in eine Dissonanz verwandelt, wenn einer der zwei sie bilden den Töne sich um einen Halbton erhöht oder erniedrigt. Die "Reinheit" der Oktav und der reinen Quint ist der Ausdruck ihrer Kompromißlosigkeit als Konsonanzen einer jeden Änderung gegenüber, welche auf ihren Zustand als solche sich beziehen könnte. Die anderen — die "unvollkommenen" — Konsonanzen, die Terz und die Sext, sind eben "unrein", weil ihre minderwertigere Konsonanzenqualität die notwendige Widerstandskraft besitzt, um sich nicht von einer Halbtonänderung ihres Umfangs zerstören zu lassen. Eine solche Änderung ist nur dazu da, um die kleine Terz (oder Sext) in eine große umzuwandeln, — oder umgekehrt, die große in eine kleine —, ohne daß sie deswegen aus der Kategorie der Konsonanzen (aber eben: unvollkommenen Konsonanzen!) ausscheidet. Eben die "Reinheit" der Quint, der letztere ihre Verwandschaft mit der Oktav verdankt, hat — ungeachtet der geringeren Ähnlichkeit des zweiten Obertons mit dem Grundton — sich als jener Faktor erwiesen, welcher schon in einer sehr fernen Vergangenheit der Quint eine mit der der Oktav identische Gehörsempfänglichkeit gesichert hat. Wie alt die Gleichstellung der Quint mit der Oktav ist, zeigen jene allerersten dem X. Jahrhundert angehörenden Versuche mehrstimmiger Musik, welche ausschließlich aus parallelen Oktaven und Quinten bestehen —, aus denselben Oktaven und Quinten, die einige Jahrhunderte später der Gegenstand strengsten Verbots geworden sind. Übrigens versteht es sich von selbst, daß mit der echten Mehrstimmigkeit diese "ersten Versuche mehrstimmiger Musik" — das Hucbaldsche "Organum" — nichts gemein hatten. Sie sind als schriftlich festgelegte Muster des relativen Einklangs aufzufassen, die jener Epoche angehören, in welcher der Begriff des Einklangs noch nicht vollkommen den Musikausübenden zum Bewußtsein gekommen war. Das "Organum" ist ein Denkmal jener Zeiten, in welchen alle Chormitglieder ein und dasselbe in verschiedenen Höhen sangen. Der Baß sang eine Oktav tiefer als der Alt, der Tenor — eine Quint höher als der Baß u. s. w. Die Gesangshöhe eines jeden Choristen war vom mittleren Register seiner eigenen Stimme bestimmt, wobei sich diese im Verhältnis zu den anderen Stimmen instinktiv an den Oktav- und Quintintervallen orientierte, welche ihr die Erhaltung des (relativen!) Einklangs garantierten. Unverkennbar handelt es sich hier um das Phänomen der Ähnlichkeit, um die Offenbarung seiner Wirkungskraft in der Musikpraxis des frühen Mittelalters. Die Stimmen suchten und fanden einander, die Stellen der Grundtöne und deren allernächster Obertöne belegend, wobei es den Singenden so gut wie überhaupt nicht zu Bewußtsein kam, daß sie gleichzeitig verschiedene Töne sangen. Später brachte es die Entwicklung des Musikbewußtseins mit sich, daß Oktav und Quint in ihrer Eigenschaft zwischenstimmlicher ("vertikaler") Intervalle von den Chorgesangsteilnehmern und den Hörern als reale und selbständige Erscheinungen wahrgenommen wurden, deren Verwendungsmöglichkeiten keinesfalls mehr auf die Stimmverdopplung allein sich beschränken konnte. So entstanden die Keime der echten Mehrstimmigkeit, in welcher die Beziehungen zwischen den Stimmen nicht nur von der Parallelbewegung, sondern von allen Bewegungsarten bedingt sind. Die parallelen Oktaven und Quinten, ihrem Wesen nach der Einstimmigkeit zugehörend, erwiesen sich nun als anachronistische Hemmung für die weitere Entwicklung der Mehrstimmigkeit und wurden als solche aus dem lebendigen Fluß der Tonkunst eliminiert.
Die Untersuchung der Konsonanzen und Dissonanzen sowie der mit ihnen eng verbundenen Obertonreihe stellt eine Sache dar, welche eine große historische Perspektive eröffnet. Obige Auseinandersetzung mit dem "Organum" bildet eine hervorragende Veranschaulichung des Schönbergschen Lehrsatzes von der Widerspiegelung der Entwicklung, welche das Gehör im Laufe der Jahrhunderte durchmacht, durch den Musikentwicklungsprozeß. Eben in diesem Zusammenhang ist es nicht überflüssig zu wiederholen, daß in einer fernen Vergangenheit die Zugehörigkeit der Terz und der Sext zur Dissonanzenkategorie einen absoluten Beweis für das Vorhandensein der Tendenz aller Dissonanzen darstellt, sich früh oder spät in Konsonanzen zu verwandeln. Diese Einsicht zwingt uns eine Kardinalfrage auf: Wenn den Dissonanzen als solchen der Anspruch auf Ewigkeit versagt bleibt, kann dann einen solchen Anspruch das Meer haben, dessen Tropfen die Zusammenklänge, die Intervalle, die Akkorde sind? Das heißt, das Tonsystem?
Somit kommen wir an unseren zweiten Leitsatz heran, der auch tatsächlich lautet: Es gibt kein ewiges Tonsystem.
Die Tonsysteme erscheinen und verschwinden eins nach dem anderen in einer Reihenfolge, deren Einheitlichkeit darauf beruht, daß die Keime eines jeden von ihnen im Inneren des ihm vorangehenden sich gebildet haben. Zu einem gewissen Zeitpunkt erscheint im Tonsystem ein Gebilde, welches ihm gegenüber zentrifugale Tendenzen offenbaren, aber nichtdestoweniger den wichtigsten Faktor seiner Entwicklung abgeben wird. An einem anderen, späten Zeitpunkt beginnt die Triebkraft dieses Gebildes nicht mehr die Entwicklung, sondern die Auflösung des Tonsystems zu fördern, und damit die Erscheinungsbedingungen eines neuen Tonsystems vorzubereiten.
Es ist wichtig in diesem Zusammenhang zu bemerken, daß die einander ablösenden Tonsysteme die aufeinanderfolgenden Glieder eines einheitlichen Prozeßes darstellen. In einem jeden dieser Glieder muß eben das Grundlegendste in dessen sich entwickelnder Struktur den Schöpfer des folgenden Gliedes abgeben, welches — tatsächlich oder nur scheinbar — mit dem Wesen seines Vorläufers in scharfem Widerspruch stehen wird. Am Schluß dieser Abhandlung wird sich heraussteilen, daß die Antinomie "tatsächlich oder nur scheinbar" eigentlich nicht vorhanden ist: das neue Tonsystem ist in seinem Wesen nichts anderes als die Reproduktion auf einer höheren Stufe des alten Tonsystems, welche eben auf der Grundlage der Gegensätze zwischen den zwei Systemen zustande kommen konnte.
Die Entwicklung, deren Etappen die aufeinanderfolgenden Tonsysteme bilden, zeichnet sich dadurch aus, daß ein jedes der letzteren einfacher als sein Vorgänger ist, eben weil es sich zu einer mannigfaltigeren Struktur durchgerungen hat. So zum Beispiel, als das tonale System entstanden war, hat die es charakterisierende Zuteilung einer jeden der sieben Stufen zu einer ihr entsprechenden, klar differenzierten harmonischen Funktion die organische Struktur des Systems im Vergleich zum vorangehenden System der Kirchentonarten in einem bedeutenden Maße erhöht und gleichzeitig eine ungeheure Vereinfachung verursacht: die sieben Kirchentonarten sind von zwei — Dur und Moll — Tonarten ersetzt worden. Eben in diesem Zusammenhang hat Schönberg (in seiner "Harmonielehre") die Vermutung geäußert, daß an einem gewissen künftigen Zeitpunkt die Dur-Moll-Tonalität von einem Tonsystem abgelöst werden könnte, welches nicht mehr zwei, sondern nur eine Tonart besitzt.
Daran, daß die Verminderung der Tonartenzahl als die Kehrseite des Ersetzungsprozesses eines Tonsystems durch ein andres angesehen werden muß, kann nicht gezweifelt werden. Das neue System zeichnet sich dadurch aus, daß es als unzertrennliches Ganzes solche gleichartige Strukturelemente aufgenommen hat, welche im vorangehenden System in völliger Absonderung voneinander vorhanden waren. Eben dies macht den Höhenunterschied ihrer Entwicklungsstufen aus. Der Gedanke Schönbergs, daß die zwei Tonarten des tonalen Systems das Ergebnis einer Synthese darstellen (daß die Verschmelzung der ionischen, lydischen und mixolydischen Kirchentonarten einerseits, und der dorischen, phrygischen und äolischen andrerseits, zur Entstehung des Dur und des Moll geführt hat), gibt uns die Möglichkeit, im Vorhandensein der harmonischen Funktionen in der Tonalität das Resultat dieser Verschmelzung zu erkennen. Vier Toniken (oder fünf —, wenn man auch die siebente, hypophrygische Tonart in Rechnung zieht, die, vielleicht, nicht mehr als einen theoretischen Begriff darstellte) haben als solche zu existieren aufgehört, um sich den zwei intakt gebliebenen Toniken, jener der Dur- und jener der Molltonart, unterzuordnen. Der Prozeß dieser Unterordnung stellt eben den Entstehungsprozeß der harmonischen Funktionen dar.
Jetzt, nachdem die ersten zwei Leitsätze dieser Arbeit auseinandergelegt wurden, ist es leicht, ihre hauptsächliche Wechselbeziehung festzustellen: Der allmähliche Aneigungsprozeß der Zusammenklänge ist die Grundlage, auf welcher der Entstehungs- und Entwicklungsprozeß der aufeinanderfolgenden Tonsysteme vor sich geht. Die vom menschlichen Gehör im ersten der zwei Prozesse angeeigneten Zusammenklänge werden im zweiten Prozeß in die vom gegebenen Tonsystem bestimmten Wechselbeziehungen hereingezogen, woraufhin ihnen die Hauptrolle in der weiteren Entwicklung des Systems zufällt.
Der dritte — letzte — Leitsatz bezieht sich auf die Struktur der Tonalität. Diese Struktur ist von der Herrschaft eines Tons — der Tonika — über alle anderen Töne gekennzeichnet, wobei die Tonika vom Gleichgewichtsverhältnis zwischen den einander antagonistischen Kräften der Dominante und Unterdominante bedingt ist.
Gleichgewicht ist aber nicht mit Gleichheit der Kräfte zu verwechseln. Die Verhältnisse der Dominante und der Unterdominante zur Tonika befinden sich zueinander im Gegensatz: die Dominante ist ein naher Oberton der Tonika, und dieses Obertonverhältnis ist nicht mit dem Verhältnis der Unterdominante zur Tonika, sondern umgekehrt, mit dem der Tonika zur Unterdominante identisch. Das heißt, daß nicht nur die Kraft der Dominante, sondern auch diejenige der Tonika keinen Vergleich mit der Kraft der Unterdominante aushalten können. Aus dieser Tatsache ergibt sich ein sehr paradoxales Bild der Unterdominante: ungeachtet dessen, daß sie im tonalen System jene Instanz darstellt, welche über die größte potentielle Kraft verfügt, muß sie, ein Gleichgewichtsverhältnis mit der — sehr schwachen! — Dominante eingehend, sich der Tonika unterordnen.
Was hat aber die Unterdominante zwingen können, sich zur Partnerschaft mit der Dominante herabzulassen und somit der Tonika freien Weg zu ihrer Herrschaft zu geben?
Bevor man diese Frage beantwortet, muß man sich darüber im klaren sein, daß die Tonika, mit welcher das Musikwerk seinen Anfang nimmt, und die Tonika, welche das Werk abschließt, ganz verschieden in ihrer Substanz und Bedeutung sind. Die anfängliche Tonika ist von der Unterdominante anfechtbar; die abschließende Tonika hat, im Gegenteil, die Unterdominante in eine ihr absolut untergeordnete Instanz verwandelt. Damit ist aber gesagt, daß das tonale Gleichgewichtsverhältnis eine dynamische Erscheinung ist, welche im Musikwerk ihre Verwirklichung findet.
Erst jetzt, nachdem wir den Rahmen erkannt haben, in welchem die Gleichstellung der Unterdominante mit der Dominante vor sich geht, können wir auch nach der Art und Weise ihres Zustandekommens fragen und sogleich auch antworten: das tonale Gleichgewicht ist auf ein Bündnis der Tonika mit der Dominante zurückzufrihren, in welchem die Initiative der Tonika gehört. Bevor wir aber das Wesen und die Entstehungsbedingungen dieses Bündnisses erörtern, wollen wir das Wort "Musikwerk" durch das Wort "Musikform" ersetzen und dem ihm entsprechenden Begriff unsere Aufmerksamkeit widmen.
Das Wort "Form" will uns die Vorstellung aufdrängen, daß es sich auf nichts anderes als auf ein besser oder schlechter geschneidertes Kleid des gegebenen Werks bezieht. Im Rahmen einer solchen bewußten oder halb bewußten Konzeption ist der Form nicht mehr als die Bedeutung einer Schicklichkeitsangelegenheit[3] beizumessen. Darauf ist es eben zurückzuführen, daß immer wieder Epochen der musikalischen Nacktkultur aufkommen, in welchen mit der Form aufgeräumt wird.
Eine ganz andere Formauffassung vermittelt uns das Schaffen der großen Meister: Es ist kein bloßer Zufall, daß man in der Zeit der Wiener Klassiker von einem Werk aus C-dur sprach —, nicht in C-dur, wie es das gegenwärtige Ausdrucksgefühl verlangt. Hinter diesem geringfügigen Unterschied der Ausdrücke verbirgt sich ein ungeheurer Unterschied der Auffassungen: die Wechselbeziehungen zwischen Harmonie und Form sind in verschiedenen Epochen eben verschieden eingeschätzt worden. Dieses "in" — in C-dur — ist der Romantik zu verdanken. Es kennzeichnet die Epoche, in welcher die zur Schablone gewordene Musikform nicht mehr organisch, sondern nur noch konventionell mit der Harmonie verbunden war. Im Gegensatz dazu konzentriert in sich das Wort "aus" den Gedanken und die Tatsache, daß die Form nichts anderes, als die Verkörperung eines Prozesses — des tonalen Prozesses — darstellt. Im Schaffen Richard Wagners — die Geschichtsschreibung hat ihn der Romantik geschenkt, obwohl in Wirklichkeit ihm die Bedeutung eines großen Meisters der Klassik zukommt — wurde die lebendige Funktion der Form wiederhergestellt. Schwerer aber als die Form selbst läßt sich ihr Begriff restaurieren.
Vielleicht kann man sagen, daß die Form jene Erscheinung ist, welche in unserem Bewußtsein die zwischen Zeit und Raum vorhandenen Schranken aufhebt. Wenn Goethe gesagt hat, daß Architektur erstarrte Musik ist, hat er damit auch der entgegengesetzten Vorstellung, — daß die Musik als flüssige (fließende) Architektur empfunden werden kann, — den Weg geebnet. Auf der Grundlage einer solchen Vorstellung ist die Musikform als ein Raum zu betrachten. Der Raum, in welchem der von der Tonika initiierte Kampf zwischen Dominante und Unterdominante vor sich geht.
Wie soll man das Wort "Kraft" — der Tonika, der Dominante, der Unterdominante — verstehen? Man könnte meinen, daß ein jeder Ton den primären Trieb hat, Grundton zu werden. Wahr ist das Gegenteil: ein jeder Ton kann nur unter gewissen Bedingungen seinem Trieb widerstehen, sich in einen anderen, eine Quint tiefer liegenden Ton (in den Ton also, in bezug auf welchen er den eigentlichen ersten Oberton darstellt) aufzulösen. Die Dominante ist schwächer als die Tonika, und die Tonika ist schwächer als die Unterdominante, weil sie sich unter der Wirkung der Anziehungskraft befinden, welche die Tonika (auf die Dominante) und die Unterdominante (auf die Tonika) ausüben. [Ein ebensolcher potentieller Auflösungstrieb der Unterdominante wird a priori durch die vereinigten Kräfte der Tonika und der Dominante neutralisiert, welche, gegen die Unterdominante gerichtet, diese unwiderruflich in ihrer Funktion fixieren.]
Wenn man im richtigen Licht die Musikform untersucht, kann man nicht nur die von Tonika, Dominante und Unterdominante in ihr besetzten Kampfpositionen erkennen, sondern auch deren strategischen Wert und Sinn verstehen.
In der Sonatenform — jener Form, die den Höhepunkt der Formentwicklung darstellt, gehören:
| das Hauptthema | — | der Tonika, |
| das Seitenthema | — | der Dominante, |
| die Durchführung | — | der Unterdominante |
| und die ganze Reprise | — | ebenfalls der Tonika. |
Dieses Schema kann den Eindruck einer gewaltsamen Simplifikation machen. Die Harmonielehre Schönbergs — die erste rationale Auseinandersetzung mit dem tonalen System — überzeugt uns aber (wie es aus dem weiter unten Folgenden ersichtlich sein wird), daß nur eine falsche Vorstellung vom Wesen der Modulation uns hier verleiten kann, das Einfache mit dem Resultat einer Simplifikation zu verwechseln.
Die Tonika tritt im Hauptsatz als Haupttonart des gegebenen Werks auf.
Als Folge ihres Erscheinens entsteht für die Tonika eine einzige Aufgabe: sich als solche zu behaupten —, d. h. die Anziehungskraft der Unterdominante von sich abzuwenden. Zu diesem Zweck tritt sie der Dominante — auf Zeit! — ihren Platz ab. Die im Seitensatz als Dominanttonart erscheinende Dominante bekommt die Funktion einer Ersatztonika, und als solche wird sie zum Ersatzobjekt der von der Unterdominante ausgestrahlten Anziehungskraft.
Die zeitweilige Umfunktionierung der Dominante ist auf die Initiative der Tonika zurückzuführen: Das Erscheinen des Seitensatzes ist vom Überleitungssatz bedingt, der die Modulation aus der Grundtonart in die Neben-(Dominant-)Tonart verkörpert. Diese Modulation geht in die entgegengesetzte Richtung vor sich als diejenige, welche die Tonika einschlagen müßte, wenn sie keine Wehrmöglichkeit gegen die Unterdominante finden könnte. Als initiativer Schritt ist die Modulation selbst zu betrachten: Die Vernichtung der Tonika durch die Unterdominante verlangt keine Modulation die Tonika löst sich einfach in die Unterdominante auf; aber der zeitweilige Verzicht der Tonika auf ihren Platz zu Gunsten der Dominante ist keine primäre Naturgegebenheit, da sich die Dominante zur Tonika genauso verhält, wie die Tonika zur Unterdominante. Deswegen ist hier eine Modulation notwendig, die nicht anders denn als eine Willenskundgebung der Tonika betrachtet werden kann. Die Tonika, — der "Grundton" — ist überhaupt als ein Naturgegebenes zu betrachten, dem die Initiative gehört, eine eigene Dynamik zu entfalten, um in der Natur (und in einem gewissen Sinne: "gegen" die Natur) als abgesonderter Wille aufzutreten.
Die Sonatenexposition ist also in ihrer Gänze dem Erscheinen der Tonika und ihren Verteidigungsmaßnahmen gegen die Unterdominante gewidmet. Die Neutralisierung der letzteren, d. h. ihre Umwandlung aus einer gegen die Tonika gerichteten Kraft in eine solche, welche dieser dient, geht in der Durchführung vor sich.
Diese Umwandlung vollzieht sich, ohne daß irgendeine Änderung in der Richtung der von der Unterdominante ausgeübten Anziehung einträte.
Als die Tonika an ihrer eigenen Stelle die Dominante als Ersatz-Tonika einsetzte, wurde sie selbst zur Ersatz-Unterdominante. Nun, nach Abschluß der Exposition, kann sie, diese neue Funktion ausübend, ihre zweite Initiative an den Tag legen: die Ersatz-Tonika zwingen, den Weg anzutreten, welcher sie zu ihrer ursprünglichen Funktion zurückführt.
Die zwei Initiativen der Tonika sind eng miteinander verbunden: die erste ist nur dazu da, um die zweite zu ermöglichen. Die Voraussetzungen der letzteren und die Art, in welcher sie verwirklicht wird, lassen sich folgendermaßen darstellen.
Die auf die Ersatz-Tonika gerichtete Anziehungskraft der Ersatz-Unterdominante ist unwiderstehlich, und zwar aus einem sehr einfachen Grund: ihre Richtung ist diesselbe, in welcher die Ur-Unterdominante wirkt.
Als die Tonika und die Dominante zeitweilig sich anderen Funktionen zuwendeten, blieb die Unterdominante ihrer ursprünglichen Funktion treu. Aus dem Gebiet des Seitensatzes verbannt, — weil dort die Tonika sie ersetzte, — bekommt die Unterdominante in der Gestalt der Durchführung ihr eigentliches Wirkungsfeld. Hier entfaltet sie ihre ganze, auf die Tonika gerichtete Anziehungskraft. Aber nun, unter den Bedingungen, in welchen die Tonika selbst eine Unterdominantenfunktion gegenüber der zur Tonika gewordenen Dominante ausübt, ist die Unterdominante kein übermächtiger Feind mehr, sondern ein ausschlaggebender Verbündeter. Unter dem Druck der vereinigten Kräfte der Unterdominante und der Tonika muß die Dominante unbedingt auf ihre Tonika-Position verzichten. Gleichzeitig aber hat die Unterdominante ihre ganze Kraft, welche die Tonika hätte zwingen sollen, ihr botmäßig zu werden, an die Wiedereinsetzung der Tonika in ihre Rechte — an die Wiederherstellung des Status quo ante — vergeudet. Dies ist das Ziel der zwei Initiativen der Tonika gewesen[4].
Die Reprise stellt die Verwirklichung dieses Ziels dar. Die Unterdominante, nachdem sie — eben ihrem Trieb nachgebend! — die Wiederaktivierung der Tonika in den Weg geleitet hat, ist nun, ihrer Übermacht bar, nicht mehr als ein gleichwertiger Partner der Dominante in einem Gleichgewichtsverhältnis, welchem keine Gefahr mehr droht. Für die Tonika ist jetzt jede Verteidigungsnotwendigkeit verschwunden. Deswegen gibt es in der Reprise keine Nebentonart, deswegen sind hier Haupt- und Seitensatz in der alleinherrschenden Grundtonart vereint. Der eigentliche tonale Prozeß ist damit zu seinem Ende gekommen.
Die Coda ist nur noch dazu da, um die Apotheose der Tonika zu feiern. Eben deswegen bildet sie — genauso wie die Durchführung — einen Tummelplatz der Unterdominante. Wenn aber letztere dort ihre Kraft blindlings zum Vorteil der Tonika vergeudet, so tritt sie hier (sozusagen: "bewußt") als Unterton der Tonika —, als einer der zwei Pfähle auf, auf welchen derer nun nicht mehr gefährdete Herrschaft beruht. Erst mit dem Tonika-Schlußakkord der Coda erreicht der tonale Gleichgewichtsprozeß seine wirkliche Vollendung.
[Dieser Grundmechanismus des tonalen Gleichgewichts hat den Höhepunkt seiner Entwicklung im Schaffen Beethovens erreicht, und ebendort entstanden seine Varianten. Ein Sonatensatz Beethovens (in seinen Klavierwerken — von Anfang an, in den anderen Werken — erst später) stellt einen besonderen Fall des Gleichgewichtsproblems dar. Wir haben uns davon Rechenschaft zu geben, daß der musikalische Charakter eines Beethovenschen Werkes die Emanation seiner Form —, der besonderen Problematik darstellt, mit welcher in diesem Werk die Realisierung des tonalen Gleichgewichts verbunden war. Zum Beispiel gibt es Werke Beethovens, in welchen alles auf den Kopf gestellt ist: die Unterdominante erscheint an Stelle der Dominante, und dennoch bringt es eine besondere Art des Tonika-Dominante-Bündnisses zustande, die Unterdominante auf ein zulässiges Maß zu reduzieren. Eben ein solches Werk emaniert jenen unbändigen Mut und jene unbändige Kraft, deren Abdruck in unserem Bewußtsein den Logarithmus des Beethovenschen Wesens bildet. Aber ein jedes Beethovensche Abnorme ist nur dazu da, um das oben auseinandergesetzte Grundlegend-Normale hervorzuheben und in seiner Gültigkeit zu bestätigen.]
Aber das Wesen der Tonalität, genauso wie das Wesen der ihr vorangehenden Tonsysteme trug in sich als Bedingung ihrer Existenz die Unvermeidlichkeit einer Weiterentwicklung, welche kaum gelenkt werden kann. Deshalb fragt es sich: Übte die Weiterentwicklung der Tonalität irgend einen Einfluß auf das sie kennzeichnende Gleichgewicht der einander entgegengesetzten Dominante und Unterdominante? Wir haben gesehen, daß dieses Gleichgewicht in einem gewissen Sinne als ein "künstliches" betrachtet werden muß, da es das Wesen der Beziehung, welche die Dominante und die Unterdominante von Natur aus miteinander haben, nicht ausdrückt, sondern ausschließlich auf die Einmischung der Tonika in diese Beziehungen zurückzuführen ist. Deswegen muß die Frage genauer formuliert werden: Hat die Fähigkeit der Tonika, das Kräfteverhältnis im tonalen System durch ihr Eingreifen zu bestimmen, sich in den Bedingungen der von der Tonalität durchgemachten Entwicklung irgendwie (in eine positive oder negative Richtung) verändert?
Um auf diese Frage die Antwort zu geben, ist es vorher notwendig den Weg und das Ziel dieser Entwicklung festzustellen und auch ihre Triebfeder zu erkennen. Von der selbstverständlichen Tatsache ausgehend, daß die Tonalität nur so lange existieren konnte wie das Gleichgewicht zwischen ihren entgegensetzten Regionen zustande zu bringen war, und die Schlußfolgerungen dieser Untersuchung vorwegnehmend, dürfen wir sagen, daß das tonale System verschwunden ist, weil seine Entwicklung notwendigerweise zur maßlosen Macht- und Bedeutungsvergrößerung der Unterdominante geführt hat. Als der Kräfteunterschied zwischen der Unterdominante und der Dominante die Grenzen überstieg, in deren Rahmen die Tonika fähig war ihre Initiative walten zu lassen, wurde die Möglichkeit des tonalen Gleichgewichts ausgeschaltet. Das Verschwinden der Tonika ist auf die Vernichtung der Dominante durch die Unterdominante zurückzuführen. Damit ist ein Kampf zu Ende gekommen, welcher nicht ohne Trojanisches Pferd vor sich gegangen war. Der Vorgang dieses Kampfes wird im folgenden geschildert.
* *
*
Die Entwicklung des tonalen Systems hat einen Prozeß dargestellt, dessen Inhalt die Einordnung aller 12 Töne unter die Herrschaft der Tonika gewesen ist.
Mit diesen Worten wird eigentlich eine neuere Auffassung der tonalen Chromatik ausgedrückt, die den Anspruch hat, deren alte Konzeption zu ersetzen. Wenn man früher in einem jeden chromatischen Ton eine Abweichung von der Tonalität sah, so muß heute, 70 Jahre nach der Aufstellung der drei grundlegenden harmonischen Schönbergschen Begriffe, — Nebendominante, Region der Moll-Unterdominante, vagierende Akkorde, — eingesehen werden, daß der chromatische Ton keine zentrifugale Erscheinung in Bezug auf die Tonika darstellt, sondern im Gegenteil eine Erscheinung ist, welche von der Tonika in die Sphäre ihrer Herrschaft hereingezogen wurde. Die sich hier offenbarende diametrale Gegensätzlichkeit von Illusion und Wirklichkeit bildet eine Parallele zur Fragelösung der Beziehungen, welche Sonne und Erde miteinander verbinden. Wer von den beiden um den anderen kreist, ist auch nicht von Anfang an klar gewesen.
In diesem Zusammenhang muß gesagt werden, daß die Vorstellung von einer tonalen "Abweichung" einer Epoche angehört, in welcher noch keine reife theoretische Einsicht in das Wesen der Tonika vorhanden war. Es war eine solche Einsicht, welche die Ergründung der Beziehung zwischen Harmonie und Form verhindert und somit ein großes Mißverständnis zur Folge gehabt hat. Eben diesem Mißverständnis war die Langlebigkeit des harmonischen Begriffs "Abweichung" zu verdanken.
Das Mißverständnis bestand (oder: besteht) darin, daß man das Vorhandensein der Modulationsmittel vom Vorhandensein der Modulationsfunktion überhaupt nicht oder nicht scharf genug trennte. Es handelt sich nämlich darum, daß die Modulation ein Zweifaches darstellt: sie ist eine harmonische Erscheinung, welche aber, was ihre Funktion betrifft, als Kategorie der Form betrachtet werden muß.
Wenn man die Form als das Instrument zur Vollziehung des tonalen Gleichgewichts anerkennt, ist es unausweichlich, den Gedanken gelten zu lassen, daß die Zahl der Modulationen, welche in einem Werk Vorkommen, der Zahl seiner Seitenthemen gleichkommt. Das heißt, daß in einem Werk nicht mehr als zwei Modultionen (und die ihnen entsprechenden Modulationen zurück in die Haupttonart) kommen können[5]. In ihrer überwiegenden Mehrzahl aber zeigen die Werke eine Struktur auf, welche von einer einzigen Modulation bedingt ist.
Eine einzige Modulation! Trotz der Unzahl von Alterationszeichen, die über das ganze Werk verstreut sind! Wie soll dann die Modulation — die einzige(!) echte Modulation — anders aufgefaßt werden als eine Erscheinung, welcher eine ganz besondere Bedeutung zukommt, und zwar eine Bedeutung, die nicht in ihrer Gänze erfaßt werden kann, wenn man sie unter dem Gesichtswinkel der Harmonie allein betrachtet? Die echte Modulation ist nur an der Funktion zu erkennen, welche sie in der den tonalen Gleichgewichtsprozeß verwirklichenden Form ausübt. Deswegen kann man ihrer Bedeutung gerecht werden, wenn man sie als Kategorie der Form betrachtet.
Die fremden Töne, welche die Modulation herbeiführen, und die anderen im Werk vorkommenden nichtdiatonischen Töne befinden sich in einem gegensätzlichen Verhältnis zueinander. Letztere sind Gäste, die aufgehört haben, Gäste zu sein. Sie können sich aus dem Gravitationsfeld einer ihnen fremden Grundtonika, in welches sie geraten sind, nicht mehr losmachen. Jene fremden Töne aber, die in der Modulation erscheinen, sind — ganz im Gegeteil — dazu da, um diatonische Töne zu begleiten, welche ermächtigt wurden fremde Gebiete aufzusuchen—, neue Funktionen in einer anderen (Neben-) Tonart zu erfüllen. In dieser von dem Seitensatz getragenen Neentonart können selbstverständlich ebenfalls fremde Töne Vorkommen, welche die Fähigkeit erworben haben, ihre diatonischen Töne zu vertreten.
Wenn man den Begriff "Abweichung" gelten läßt, versperrt man sich den Weg zur Einsicht, daß die Beziehung zur Tonika derjenigen nichtdiatonischen Töne, welche an einer Modulation nicht beteiligt sind, eine innertonale Angelegenheit darstellt. Diese Beziehung kann leicht verstanden werden, wenn man das Pseudoaxiom der ewigen Tonalität aufgibt wenn man die Tonika nicht als eine für alle Zeiten erstarrte Erscheinung auffaßt, sondern als eine solche, die evolutionsfähig ist.
Der Begriff "Abweichung" hat für die von der Theorie künstlich im Zustand der Erstarrung erhaltene Tonalität die Rolle eines Futterals gespielt. Diesen Begriff hat Schönberg durch einen anderen, durch den Begriff der Nebendominante, — ersetzt, dem zu verdanken ist, das einige Grundbegriffe der Harmonielehre vom Kopf auf die Beine gestellt werden konnten.
Die Nebendominante ist eine Dominante, welche nicht auf der V., sondern auf einer anderen Stufe sich befindet. Eine jede Tonart kann von den Tonarten, mit welchen eine Verwandschaft ersten Grades sie verbindet, deren Dominanten entlehnen und eigenen Stufen zuteilen. In C-dur erscheinen als Nebendominanten:
| auf der | I. | Stufe — die von der Tonart | F-dur | entlehnte Dominante | ; |
| —"— | II. | —"— | G-dur | —"— | ; |
| —"— | III. | —"— | a-moll | —"— | ; |
| —"— | VI. | —"— | d-moll | —"— | ; |
| —"— | VII. | —"— | e-moll | —"— | ; |
Diese fünf Nebendominanten, dargestellt als Dominantseptakkorde, bringen in die Tonart alle jene Töne hinein, welche ihrem diato¬nischen Bestand nicht angehören.
| I | — — | b | (die Septime), | ||
| II | — — | fis | (die Terz), | ||
| III | — — | gis | (— " —), | ||
| VI | — — | cis | (— " —) und | ||
| VII | — — | dis | (— " —) | ||
| — — | fis | (die Quint) |
Dank dieser Dominanten enthält folglich die Tonart nicht sieben, sondern alle zwölf Töne.
Es lohnt sich zu bemerken, daß die von den Nebendominanten aus den nächstverwandten Tonarten in die (Grund-)Tonart hineingebrachten fünf fremden Töne jene Namen tragen, welche für die steigende chromatische Tonleiter charakteristisch sind.
Die Tatsache, daß jene fremden Töne, welche an der Modulation nicht beteiligt sind, der Tonika gegenüber nicht zentrifugal auftreten, sondern, im Gegenteil, deren Anziehungskraft nachgebend, sich ihr unterordnen, läßt sich durch die Anwesenheit der Nebendominanten in der Kadenz am besten nachweisen. Nirgends so augenscheinlich wie in der Kadenz offenbart sich die Herrscherposition, welche die Tonika allen anderen Tönen gegenüber einnimmt, aber auch die Fähigkeit der Nebendominanten, die diatonischen Akkorde in ihrer Eigenschaft als Träger der tonalen Funktionen zu ersetzen. Mit anderen Worten: das Wesen der Kadenz bürgt dafür, daß nicht immer die "fremden" Töne fremd sind!
Aus der Auseinandersetzung mit der Bedeutung, welche den Nebendominanten als Elemente der Kadenz zukommt, ergibt sich, — wie man hätte vermuten können —, daß Schönbergs Auffassung der Kadenz mit der anderen, seit jeher allgemein angenommenen, nicht übereinstimmt. Was man vor Schönberg "Kadenz" nannte, war für ihn nicht mehr als das Endchen der Kadenz.
Man darf behaupten, daß die Kadenz einen dehnbaren Begriff darstellt. An ihrer Verwirklichung können alle Stufen der Tonalität Anteil nehmen, wobei, wie schon erwähnt, als Träger der Stufen nicht nur diatonische, sondern auch solche Akkorde auftreten, in deren Bestand fremde Töne vorhanden sind.
Der Umfang der Kadenz wird von der Form bedingt —, deren Sinn und Wesen können nur unter dem von der Form gebildeten Gesichtswinkel verstanden werden: Die Kadenz des Hauptsatzes besteht wirklich nur aus einigen wenigen Akkorden, diejenige des Seitensatzes ist schon bedeutend größer, und das, was "Schlußsatz" genannt wird, ist nicht anders denn als eine weitläufige, die Sonatenexposition abschließende Kadenz zu betrachten. Die Coda in ihrer Gesamtheit ist auch eine Kadenz —, diejenige umfangreichste, welche sich auf das Werk als Ganzes bezieht.
Wie schon erwähnt, können alle Stufen der Tonalität in der Kadenz erscheinen, wobei alle die Fähigkeit besitzen, Träger von Nebendominanten zu sein. Die Kadenzen

|

|
unterscheiden sich funktionell überhaupt nicht voneinander. Zwischen den folgenden zwei Kadenzen

|

|
gibt es ebenfalls keinen funktionellen Unterschied.
Es versteht sich von selbst, daß eine bedeutendere Erweiterung der Kadenz
nicht leicht eine diatonische "Übersetzung" erfahren kann, aus dem einfachen Grund, daß das Reichhaltige keinen adäquaten Ausdruck in der Sprache der Armut finden kann. 12 und 7 sind verschiedene Größen. Der Aktionsradius der Tonika, dessen Größe von der Zahl der sich ihr unterordnenden Töne, aber auch von der differenzierten Entwicklung dieser Unterordnung abhängt, bedingt die ihm entsprechende Mannigfaltigkeit — den ihm entsprechenden Reichtum — der Tonalität.
Der Zahl der Töne, welche Eingang in die Tonalität gefunden haben, kommt eine große Bedeutung in Bezug auf die Spannweite der Tonalität, nicht aber — einstweilen — auf ihre Wesenheit zu. Ganz unabhängig davon, ob ihr sieben oder zwölf Töne zur Verfügung stehen, ist sie vom Vorhandensein der Tonika bedingt. Im Gegensatz zum Verhältnis der diatonischen Tonalität mit der chromatischen befindet sich das Verhältnis der letzteren mit dem in den späten Werken Schönbergs sich herausbildenden Zwölftonsystem: hier ist die Zahl der Töne, nicht aber die Wesenheit der Systeme identisch; das Zwölftonsystem kennt keine Tonika! (Eine vorsichtigere Formulierung ist vorzuziehen: Das Zwölftonsystem kennt keine Tonika im alten Sinne dieses Wortes.)
Das Grundprinzip des Schönbergschen Zwölftonsystems ist allgemein bekannt. Es besteht in der "Gleichberechtigung" aller zwölf Töne. Diese Gleichberechtigung drückt sich in der Unmöglichkeit der Wiederholung eines jeden Tons aus, solange alle andere Töne — gleichgültig ob im vertikalen oder horizontalen Verhältnis zueinander — noch nicht erschienen sind. Die zwölf Töne erscheinen in einer bestimmten Ordnung. Sie bilden eine "Reihe", die eigentlich — und dies ist die Hauptsache — eine Intervallenordnung darstellt. Eben diese Ordnung schließt die Möglichkeit einer Tonwiederholung — bevor alle Töne erschienen sind — aus, und somit wird das quantitative Übergewicht eines Tons ausgeschlossen.
Das tonale Gleichgewicht, die Tonika als solche bedingend, war gleichzeitig die indirekte Ursache ihres (im Rahmen der Form sich offenbarenden) derartigen Übergewichts.
Der Umschlag des Heftes, in das der hier abgedruckte Text geschrieben wurde, trägt die Aufschrift: Свободный перевод, недоведенный до конца [Freie Übersetzung, nicht bis zum Ende geführt].
Es handelt sich um die vom Autor verfaßte Teilübersetzung (auch mit Hinzufügungen) eines russischen Originaltextes, der 1973 zum ersten Mal publiziert wurde.
Publikationen:
Тональные истоки шёнберговой додекафонии, in: Труды по знаковым системам, 6, Tartu 1973, 344-379.
Le fonti tonali della dodecafonia di Schoenberg, in: Nuova rivista musicale italiana, 4, 1974, 540-578 (italienische Übersetzung: Jurij Maltsev).
Тоналните източници на Шьонберговата додекафония, in: История на музиката на XX век, Sofija, 1986, 109-147 (bulgarische Übersetzung: K. Belivanov).
Das russische Original ist auch abgedruckt in: I, 13-45. Von den 33 Seiten, die der Text dort einnimmt, umfaßt die hier vorliegende Übersetzung die ersten 14.
Diese deutsche Übersetzung wurde von Herschkowitz Mitte der 80er Jahre noch in Moskau geschrieben.
Примечания
- ↑ Es genügt von den bloßen Intervallen zu sprechen, da der Akkord nur dissoniert, wenn er ein dissonierendes Intervall enthält.
- ↑ Die heutige Perspektive trägt wenig zum Verständnis des Vorhandenseins zweier Kategorien von Dissonanzen bei: perfekter (reine Oktaven und Quinten) und imperfekter (kleine und große Terzen). In diesen Kategorien verbirgt sich eine archäologische Spur jener fernen Zeiten, als die Terz und ihre Umkehrung noch als Dissonanzen aufgefaßt wurden.
- ↑ vgl. die Formulierung "dass Formen Lebensdinge sind und nich Schicklichkeitsgegenstände" (Brief XVIII an Alban Berg, in diesem Band). Als Herschkowitz Österreich verlassen mußte, wurde auch sein Kontakt mit der deutschen Sprache unterbrochen. Die durch alle Wechselfälle treu bewahrte Einheit seines Denkens wird auch daran deutlich, daß er fünf Jahrzehnte später, als er ein zweites Mal auf deutsch zu schreiben begann, fast diesselben Formulierungen fand wie in den vergessenen Briefen an Berg.
- ↑ Wie oben gesagt, ist der Hauptsatz als Verkörperung der Tonika aufzufassen. Wenn wir in diesem Zusammenhang zur Kenntnis nehmen, daß der die Modulation in die Neben-(Dominanten-)Tonart besorgende Überleitungssatz in den allermeisten Fällen die Thematik des Hauptsatzes übernimmt, können wir den richtigen Sinn uns aneignen, welcher den Worten "Initiative der Tonika" zukommt. Was die Darstellung selbst des Hauptsatzes als Verkörperung der (von der Grundtonart personifizierten) Tonika betrifft, muß auf jenen Grundsatz Anton Weberns hingewiesen werden, welcher lautet: Der Hauptsatz moduliert nicht. Es soll heißen: Außer in besonderen Fällen geht keine Modulation im Rahmen des Hauptsatzes vor sich. Das Verständnis dieses Grundsatzes setzt die Vertrautheit mit Schönbergs "Harmonielehre" voraus. Die in diesem Buch erfolgte Präzisierung des Modulationsbegriffs hat eine außerordentliche Bedeutung für die Entwicklung der Formlehre gehabt.
Auch wurde hier im Zusammenhang mit dem Wesen des tonalen Gleichgewichts ausschließlich, der Anschaulichkeit halber, von den Wechselbeziehungen der Dominante und Unterdominante gesprochen. In der Tat aber handelt es sich um mehr —, um die Wechselbeziehungen ihrer "Regionen". Die "Region der Dominante" und die "Region der Unterdominante" sind sehr wichtige Begriffe der Schönbergschen Harmonielehre. Im Weiteren werden wir Gelegenheit haben, uns näher mit diesen Begriffen auseinanderzusetzen.
- ↑ Zwei Modulationen können im großen Rondo Vorkommen, in welchem es zwei Seitensätze gibt.
Wenn Fragen des tonalen Systems nicht anders als im Rahmen der Form-gegebenheiten betrachtet werden können, ist es die Beethovensche Form,— der Höhepunkt der musikalischen Formentwicklung —, welche eine solche Betrachtung ermöglicht.
Harmonie und Form weisen keine synchrone Entwicklung auf. Erst nachdem die Harmonie eines gegebenen Tonsystems ein sehr hohes Entwicklungsstadium erreicht hat, beginnt die diesem System entsprechende Form die Entfaltung ihrer Entwicklung zu beschleunigen. So ist es zu erklären, das J. S. Bach, in dessen Schaffen die Tonalität ihren ersten Höhepunkt erreicht hat (im weiteren wird es ersichtlich sein, warum Bach von Schönberg als "der erste, der mit 12 Tönen komponierte" bezeichnet wurde), ein Meister der polyphonen Formen war —, der Formen, welche letzten Endes noch auf das mittelalterliche Tonsystem der Kirchentonarten zurückzuführen sind. Der Harmonie-Höhepunkt "Bach" hat aber den Form-Höhepunkt "Beethoven" bedingt. Die Höhenpunkt der homophonen Form. Derjenigen, die zum Charakteristikum des tonalen Systems werden mußte.
- ↑
1 die Terz der Nebendominante auf der VI. Stufe 2 - " - — " — VII. — " — 3 - " - — " — II. — " — Quint — " — VII. — " — 4 Terz — " — III. — " — 5 Sept — " — I. — " —